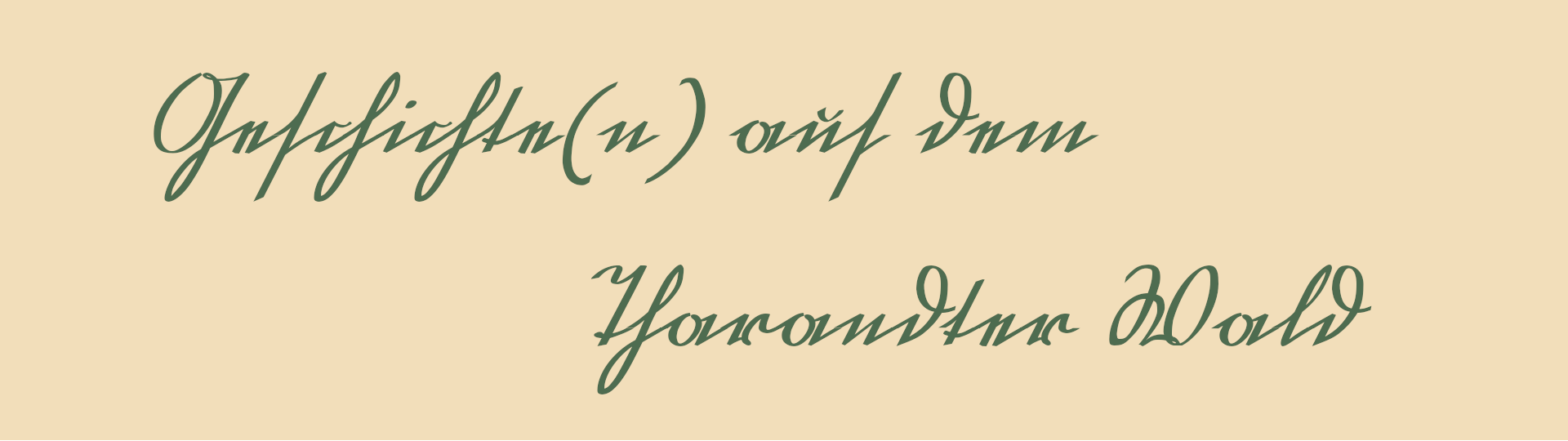Die Parochie Tharandt wurde früher von der Stadt allein gebildet, bis 1855 das Dorf Großopitz (jetzt zu Tharandt gehörend) hier eingepfarrt wurde. Vor Einführung der Reformation war Tharandt nach Fördergersdorf eingepfarrt; in einer alten Urkunde heißt es: “daß der Pfaff zu Gersdorf hier den Gottesdienst verrichtet habe”. 1555 wurde vom Kurfürst August die Pfarre hier errichtet und datiert, und am 28. April desselben Jahres hielt der erste Pfarrer, Donat Menzel, hier seine erste Predigt. Insgesamt amtierten seit 1555 bis heue 20 Geistliche.
Wie schon bemerkt, hatten gewaltige Überschwemmungen die alte Kirche in den Jahren 1559 und 1563 so sehr beschädigt, daß man sie nur mit Mühe wiederherstellen und befestigen konnte und den Gedanken faßte, sie an eine andere Stelle zu versetzen, wozu die Genehmigung im Februar 1624 erfolgte, der Bau 1626 in Angriff genommen und 1629 vollendet wurde. Die Einweihung erfolgte 1631.
Die in ihren Bittschriften von den Kirchenväter und Ältesten der Gemeinde ausgesprochene Hoffnung, daß die Kirche auf ihrem neuen erhabenen Standorte am besten vor Wassers- und Feuersgefahr gesichert sei, ging nur zum Teil in Erfüllung; vor dem Wasser war sie allerdings geschützt, nicht aber vor dem Feuer, denn in den Jahren 1717, 1793 und 1803 schlug der der Blitz in den Turm und beschädigte ihn. 1807 brannte der Turm, wie schon erwähnt, ab, wurde 1808 in seiner jetzigen Gestalt erbaut und am 9. Oktober desselben Jahres die neuen Glocken eingeweiht.
Im April 1806 hat man das Thor und die alte im Jahre 1768 angeschaffte Orgel weggenommen und die neue, vom Orgelbaumeister Renser – Dresden für 950 Taler gebaute Orgel am 3. August desselben Jahres geweiht. Im selben Jahr wurden auch der Taufstein und die Kanzel verändert und die östliche Tür angelegt. Die Kosten für den Umbau des 1807 abgebrannten Turmes und der Glocken beliefen sich, obgleich das Bauholz aus der Staatswaldung unentgeltlich geliefert wurde, auf 3500 Taler. Im Jahre 1861 zersprang die kleine Glocke und mußte umgegossen werden. Das gegenwärtige Ansehen erhielt das Innere der Kirche durch den am Reformationsfest 1839 vom damaligen Bürgermeister Köhler angeregten Umbau, der in den Jahren 1840 und 1841 mit einem Kostenaufwand von 2500 Talern zur Ausführung kam.
Nicht ohne Interess ist es, daß damals an den alten Mauern, die man wegen Vergrößerung der Fenster abbrach, Säckel, gebräunte Haferkörner und angebrannte Holzstücke fand. Man schloß aus diesem und anderen Umständen, daß der östliche Teil des Schloßes, aus dem die Kirche gebaut worden ist, jüngeren Ursprungs sei, daß er durch eine Feuersbrunst zerstört sein müsse und daß sich Futterböden dort befunden haben könnten. Eine an der Außenseite der östlichen Giebelwand hängende Tafel enthält folgenden Vers von Pfarrer Voigt:
Hier, wo dein Volk anbetend vor dir kniet,
Und ring umher in blühendem Gefilde,
Das unser Aug’entzückt und staunend sieht,
Erscheinst du, Gott, inder Größ’ und Milde.
Den Tempel, den die Väter dir geweiht,
Hast du mit Paradiesespracht umgeben,
Oh, möchten wir in reiner Frömmigkeit,
Den Engeln gleich, durch Unschuld dich erheben.
Unter dem Haupteingange am Westguiebel stehen die Worte “Die Unvergänglichen”; eine dort eingemauerte Steintafel trägt die Inschrift: “Als Churfürst Johan Georg regiert, Christian Trost diesmambt presicirt. Matthias Schönert Pfarrer war, nach Christi Geburt MDCXXVI Jahr, jaben dieses Orts ein erbar Rath Kirchvater altsten und ganzer Kirchfahrt, neu diesen Thurm und Gotteshaus erbaut aus dem Grund heraus.”
Auf einem Platze vor der Kirche, auf einer Terrasse, erhebt sich eine Sandsteinpyramide, auf deren Vorderseite sich die Namen Ernst Julius Hafert, Carl Edmund Richter, Ernst Hermann Schneider, Carl Magnus Wilhelm Schubert, Louis Gustav Heidling befinden. Über diesen Namen prangt ein Lorbeerkranz. Auf der Rückseite stehen die Worte: “Ihren für Deutschlands Macht und Ehre gebliebenen Söhnen die dankbare Vaterstadt 1871.” Das den im Weltkrieg gefallenen Helden gesetzte Denkmal hat seinen Standort auf dem Ruinenplatze erhalten.
Quelle: Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse, mit Loschwitzer Anzeiger, 11.09.1924